|
|
 |
Krieg und Politik im 21. Jahrhundert
von Martin Hoch
I. Einleitung
"Krieg ist die Hölle." So das knappe, aber provokante Resümee von William T. Sherman (1830-1891), einem der erfolgreichsten Generäle der Union im amerikanischen Bürgerkrieg, gegen Ende seiner militärischen Karriere im Jahre 1879. Nur wenige andere Themen vermögen es - wie der Krieg -, in politischen und akademischen Diskussionen Emotionen freizusetzen und Überzeugungen aufeinander prallen zu lassen, stehen sich dabei doch oft gegensätzliche Menschenbilder und Weltsichten gegenüber. Den Ausführungen über die Zukunft des Krieges, die im Mittelpunkt dieses Beitrags steht, seien daher einige Bemerkungen grundsätzlicher Natur vorangestellt.
Krieg ist ein universales Phänomen in der Geschichte und ein zentraler Bestandteil menschlicher Erfahrung: Er ist zu finden bei nahezu allen Völkern und Kulturen, in fast allen Perioden und Erdteilen. Spätestens seit dem Neolithikum ist die Geschichte der Menschheit auch eine Geschichte des Krieges. Eine Selbstverständlichkeit ist der Krieg deswegen aber nicht: Es ist vielmehr der Frieden, der durch nahezu alle Kulturen und Perioden als konzeptioneller Bezugspunkt menschlichen Handelns, als "Normalzustand" angesehen wird. Der Krieg hingegen wird als Ausnahme empfunden und erfordert, im Gegensatz zum Frieden, aufgrund seines agonalen Charakters fast durchgängig eine besondere Begründung oder Rechtfertigung.
Gleichwohl ist Krieg aber von Menschen durch die Geschichte hindurch als ein Erfolg versprechendes Instrument politischer Interaktion angesehen worden. Offenbar sind Menschen für eine Vielzahl von Motiven bereit, Leben zu nehmen beziehungsweise ihr eigenes Leben zu verlieren. Dieser Sachverhalt rechtfertigt oder verharmlost Krieg in keiner Weise. Er macht aber deutlich, dass das hehre Ziel der vollständigen Eliminierung einer derart widerstandsfähigen sozialen Institution wie des Kriegs sehr schwer zu erreichen ist. Und zwar zu schwierig, als dass man es bereits durch eine bloße Feinabstimmung schon vorhandener oder in der Entwicklung befindlicher Regulationsmechanismen der internationalen Politik oder des Völkerrechts erreichen könnte.
Aller Voraussicht nach wird Krieg - und zwar weitgehend unabhängig von seiner ethischen Stigmatisierung - ein zentraler Bestandteil des politischen Wirkens auch im 21. Jahrhundert sein. Welche Formen er dabei annehmen wird, welche Entwicklungen für die Transformation des Kriegs bestimmend sein werden und welche Konsequenzen sich daraus für die Zukunft des Krieges sowie für das Verhältnis von Krieg und Politik ergeben werden, ist Gegenstand der folgenden Überlegungen.
II. "Großer Krieg" und "kleiner Krieg"
In der auf die Neuzeit fokussierten, eurozentrischen Perspektive erscheint der Krieg zwischen Staaten bzw. zwischen den regulären Streitkräften dieser Staaten als Normalfall. Der Krieg in seiner zwischenstaatlichen Form hat bis in die Gegenwart hinein das Bild des Krieges nicht nur in Politik, Streitkräften und Öffentlichkeit, sondern auch in der Wissenschaft geprägt. Durch eine solche Sichtweise wurde und wird jedoch verdeckt, dass der Krieg zwischen Staaten nur in einer vergleichsweise kurzen historischen Phase und in einem beschränkten geographischen Raum die vorherrschende Kriegsform war.
Die Auffassung vom Krieg als einem Rechtszustand zwischen Staaten setzte sich zuerst in der Folge des Dreißigjährigen Krieges in Europa durch und ist in engem Zusammenhang mit der Herausbildung des Territorialstaates zu sehen. Nunmehr hatten allein Staaten bzw. ihre regulären Streitkräfte das Recht, Krieg zu führen. Dies bedeutete gegenüber der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges auch eine Einhegung des Krieges: Er sollte von nun an nach den kodifizierten Regeln eines immer weiter ausdifferenzierten Kriegsrechts und Kriegsvölkerrechts geführt werden. Eine der wichtigsten Auswirkungen war, dass - zumindest in der politischen und militärischen Vorstellungswelt - im Regelfall nur noch die Streitkräfte des Gegners als legitimes Ziel militärischer Handlungen gelten sollten, nicht aber die Zivilbevölkerung. Diese Einhegung des Krieges war allerdings auf die Beziehungen zwischen europäischen bzw. atlantischen Staaten beschränkt: Bezeichnenderweise galten die rechtlichen Beschränkungen, die nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges in diesem zwischenstaatlichen Kriegskonzept zum Tragen kamen, nicht für die gleichzeitigen Kriege dieser Staaten in ihren Kolonien oder gegen andere, nichteuropäische Völker.
Sowohl in der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg wie parallel zum zwischenstaatlichen Krieg in der Zeit nach 1648 war und ist stets auch eine ganz andere Kriegsform präsent. Sie ist nicht - wie der zwischenstaatliche Krieg - durch gegenseitig anerkannte Regeln gekennzeichnet, sondern gerade durch deren Abwesenheit. Es sind dies die so genannten "kleinen Kriege". Synonym spricht man auch von low-intensity conflicts, von "asymmetrischen Kriegen" oder von "Partisanen-" bzw. "Guerillakriegen"; kürzlich sind Bezeichnungen wie "postnationaler Krieg" und "neo-hobbesscher Krieg" hinzugekommen. Dabei handelt es sich um all jene Kriege, die nicht zwischen den regulären Armeen moderner Staaten ausgefochten werden. In unserer Zeit treffen in kleinen Kriegen zumeist die regulären Streitkräfte von Staaten und nichtstaatliche Akteure als Gegner aufeinander.
Keine der angeführten Bezeichnungen wird dem Phänomen des kleinen Krieges wirklich gerecht; in ihm offenbart sich die ursprüngliche, ungehemmte Form des Krieges. Sie umfasst Aufstände ebenso wie Bürgerkriege, Eroberungskriege oder Vernichtungskriege. Bei ihnen handelt es sich um die überwiegende Mehrzahl der Kriege in der Geschichte der Menschheit. Die großen, zwischen Staaten und regulären Streitkräften sowie unter Einhaltung gegenseitig vereinbarter Regeln geführten Kriege sind demgegenüber die Ausnahme gewesen.
Und die kleinen Kriege sind nicht notwendigerweise "kleiner" als die großen Kriege - weder in ihrer Intensität noch in ihrer Dauer, noch in ihrer Zerstörungskraft. Kennzeichnend für die kleinen Kriege ist die Abwesenheit bzw. Durchbrechung verbindlicher Regeln für die Kriegführung, die in der fehlenden Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, dem Herzstück des modernen humanitären Völkerrechts, am augenfälligsten wird. Aber auch die Grenzen zwischen Krieg und Frieden sind in ihnen fließend: Die Folge ist, dass die gewohnte klare (und in rechtlichen Kategorien gefasste) Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden, welche dem modernen westlichen Verständnis zugrunde liegt, für kleine Kriege gar nicht mehr getroffen werden kann. Auch die enge Verbindung mit mehr oder minder organisierter Kriminalität - etwa dem Drogenhandel, um nur ein Beispiel zu nennen - ist für den kleinen Krieg typisch.
Der kleine Krieg ist per definitionem entgrenzt, alle Mittel kommen in ihm zum Einsatz, und oft nimmt er in seiner charakteristischen Brutalität - insbesondere gegenüber Nichtkombattanten, hier vor allem Frauen und Kinder - Züge an, die mit dem Phänomen des totalen Krieges in Zusammenhang gebracht werden: Die Gesamtheit des Gegners, und nicht nur dessen Kombattanten, wird als Feind angesehen und bekämpft. Die Symmetrie, also die Beschränkung des Kampfes auf die Kombattanten, kennzeichnet den großen Krieg; für den kleinen Krieg hingegen ist die bewusst angestrebte Asymmetrie im Kampf gegen die verwundbarste Stelle des Gegners, eben die Nichtkombattanten, charakteristisch. Daher rührt der hohe Anteil von Zivilisten unter den Opfern kleiner Kriege. Auch reguläre Streitkräfte, die in einem kleinen Krieg gegen irreguläre Kräfte eingesetzt werden, tendieren dazu, sich die regellose Kampfesweise des Gegners zu Eigen zu machen.
Kleine Kriege werden oft in schwierigem Terrain - wie urbanen Großräumen, Dschungeln bzw. bewaldeten Gebieten oder schwer zugänglichen Bergregionen - ausgefochten, auf dem die vergleichsweise schweren und hochtechnologieorientierten Kampf- und Aufklärungsmittel regulärer Streitkräfte nur in begrenztem Umfang eingesetzt werden können. Auch der rasante technische Fortschritt und die praktisch unbeschränkte Nutzbarmachung von Kommunikations- und Informationstechnologien begünstigen die nichtstaatlichen Akteure: Immer kleinere Einheiten verfügen über immer größere Kräfte, z.B. bei Hacker-Angriffen auf Datennetze, dem so genannten cyber bzw. information warfare. Gerade solchen Gegnern kommt zugute, dass sie mit preiswerten Mitteln eine große Wirkung erzielen können, dass sie schwer zu identifizieren sind und keinen klar definierten Aufenthaltsort oder eine Basis haben, die sie angreifbar machen würden.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs rückten die kleinen Kriege zunächst als Befreiungskriege gegen Kolonial- oder Besatzungsmächte und seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes vermehrt in der Form ethnisch motivierter Konflikte, wie etwa auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, wieder stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit; gleichzeitig gewinnen sie auch in den Überlegungen von Politik und Streitkräften immer mehr an Bedeutung. Die treibende Kraft dieser Entwicklung ist die zahlenmäßig starke Zunahme von nichtstaatlichen Akteuren in der internationalen Politik, die auch immer mehr Gewicht und Einfluss erlangen. Zu ihnen zählen neben klassischen Befreiungsbewegungen und Guerillaorganisationen Strukturen der organisierten Kriminalität, private military companies sowie private Sicherheits- und Nachrichtendienstorganisationen. Sie können sowohl im eigenen Interesse als auch im Auftrag eines Staates oder eines anderen nichtstaatlichen Akteurs tätig werden. Es liegt auf der Hand, dass das Beziehungsgeflecht der internationalen Politik durch diese Entwicklung erheblich komplexer gestaltet wird.
In der strategischen Community ist diese Entwicklung unter dem Schlagwort der "Rückkehr des Mittelalters in der Sicherheitspolitik" geläufig. Diese Formulierung beschreibt, dass Staaten nicht länger die einzigen Träger von Gewalt in der internationalen Politik sind. Die Folge einer zunehmenden Privatisierung von Gewalt und Krieg ist die Auflösung des staatlichen Gewaltmonopols und das Nebeneinander bzw. die Konkurrenz staatlicher und nichtstaatlicher Machtausübung. Die Mehrzahl der Kriege seit 1945 wurde und wird nicht zwischen Staaten, sondern zwischen Staaten und nichtstaatlichen Akteuren geführt, sind also kleine Kriege; sie werden als vorherrschende Kriegsform das Bild des 21. Jahrhunderts entscheidend mit prägen.
Daraus folgt jedoch nicht, dass im Konfliktspektrum des 21. Jahrhunderts generell die kleinen Kriege an die Stelle der großen Kriege treten werden. Kennzeichnend für das 21. Jahrhundert wird eine Vervielfältigung der Konfliktszenarien sein, nicht ein Ersatz von bisherigen Szenarien durch andere. Auch Szenarien massiver konventioneller Konflikte zwischen regulären Streitkräften von Staaten wird es weiterhin geben, wie auch die Möglichkeit eines nuklearen Schlagabtausches oder des Einsatzes von biologischen und chemischen Waffen. Daneben wird es aber eine Vielzahl weiterer, asymmetrischer Konfliktszenarien geben, in denen nichtstaatliche Akteure eine zentrale Rolle spielen.
III. Die Unterscheidbarkeit ziviler und militärischer Ziele
Unabhängig von der zu erwartenden Zunahme kleiner Kriege ergeben sich auch für Szenarien großer Kriege zwischen den regulären Streitkräften von Staaten nicht zu unterschätzende Veränderungen. Bemerkenswerterweise konvergiert die wichtigste dieser Entwicklungen des großen Krieges mit einem zentralen Wesensmerkmal des kleinen Krieges, nämlich der fehlenden Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, zwischen zivilen und militärischen Zielen. Die Unterscheidung - präziser gesagt: die Unterscheidbarkeit - ziviler und militärischer Ziele stellt das große Problem des zwischenstaatlichen Krieges im 21. Jahrhundert dar. Die Unterscheidung zwischen (legitimen) militärischen und (zu vermeidenden) zivilen Zielen bzw. zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten ist in den westlichen Gesellschaften wie in den Streitkräften verinnerlicht worden. In unserer Zeit kann der Vorwurf der Barbarei nur noch in den seltensten Fällen erhoben werden; zu diesen Ausnahmen zählt aber bezeichnenderweise die bewusste Kriegführung gegen Nichtkombattanten, vor allem Frauen und Kinder. An diesem Sachverhalt wird deutlich, wie sehr die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten zu einem zentralen Bestandteil des westlichen zivilisatorischen Selbstverständnisses geworden ist.
Es ist folglich nur konsequent, dass die durch den Einsatz von Präzisionswaffen versprochene Trennschärfe zwischen zivilen und militärischen Zielen - ein Kernaspekt der so genannten Revolution in Military Affairs - eine wichtige Rolle bei der Legitimierung von westlichen Militäreinsätzen gegenüber der eigenen Bevölkerung spielt: Im Kosovokrieg sollte der Einsatz von Präzisionswaffen so genannte Kollateralschäden an zivilen Personen und Einrichtungen nach Möglichkeit vermeiden. Bekanntlich wurden zahlreiche Ziele nicht angegriffen, weil deren eindeutige Identifizierung nicht möglich war, während die gelegentliche Zerstörung ziviler Ziele als Folge von Planungsfehlern, Fehlidentifizierungen oder unglücklichen Konstellationen zu einem Sturm der Entrüstung führte und hektische apologetische Bemühungen von Seiten der NATO zur Folge hatte.
Analysten wie etwa Martin von Creveld argumentieren nun aber, dass es gerade die Zerstörung der serbischen Infrastruktur war, welche Serbien zum Einlenken brachte - also die Zerstörung nicht rein militärischer Ziele, sondern von solchen, die sowohl für den militärischen Apparat als auch für die Zivilbevölkerung wichtig waren. Dabei ist die mangelnde Fähigkeit, bei der Infrastruktur des Gegners zwischen zivilen und militärischen Zielen zu unterscheiden, ausdrücklich nicht auf unzureichende technische Möglichkeiten, versehentliche Fehlidentifizierungen oder gar ein bewusstes Aufgeben der Unterscheidung ziviler und militärischer Ziele zurückzuführen. Es geht vielmehr darum, dass eine solche Unterscheidung nicht mehr vorgenommen werden kann, weil sie keine Entsprechung in der Realität mehr hat: An der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert können weite Teile der Infrastruktur einer Konfliktpartei nicht mehr in zivile und militärische Komponenten aufgeteilt werden.
Dies ist unter anderem eine Folge des technischen und gesellschaftlichen Fortschritts, der sich bereits in den Kriegen des 19. und 20. Jahrhunderts in einer deutlichen Tendenz zur Totalisierung konkretisiert hat. Konfliktparteien greifen ganz selbstverständlich auf sämtliche Ressourcen zu, die für Kriegsanstrengungen eingesetzt werden können, einschließlich der meisten überwiegend zivil genutzten, wie etwa die Strom-, Kommunikations- oder Verkehrsnetze, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese werden damit aber auch zum Ziel der militärischen Schläge des Gegners. Und mit der Verfügbarkeit von Flugzeugen und weitreichenden Abstandswaffen können sich die Kampfhandlungen vom ersten Tag an auf das gesamte Territorium des Gegners und auf alle seine kriegswichtigen Ressourcen erstrecken. Die herkömmliche Unterscheidung zwischen der Front und den rückwärtigen, unmittelbaren Kampfhandlungen entzogenen Gebieten wird damit aufgelöst. Auch die zunehmende Verlagerung von Kampfhandlungen in Städte und bebautes Gelände, und damit in eine Konzentration von Nichtkombattanten hinein, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass zivile Personen und Einrichtungen zu Schaden kommen.
Während die westlichen politischen und militärischen Führungen ihrem Selbstverständnis gemäß von einer fortgesetzten Unterscheidbarkeit ziviler und militärischer Ziele ausgehen (und ausgehen müssen), ist diese Unterscheidung in der Realität immer weniger gegeben. Die große Herausforderung des Krieges im 21. Jahrhundert besteht daher nicht darin, ein Ziel möglichst genau zu treffen, sondern darin zu entscheiden, was überhaupt als ein legitimes Ziel anzusehen ist. Letztlich ist die Frage, ob es sich bei einer Brücke, einem Telefonknotenpunkt, einer Raffinerie oder einer Stromerzeugungsanlage um ein legitimes Ziel handelt, nicht mit Sicherheit und schon gar nicht a priori zu beantworten. Die Entscheidung über die faktische Legitimität eines Zieles wird - zumindest in den westlichen Staaten - durch die Akzeptanz der Militäraktionen in den eigenen Bevölkerungen (und damit in der Regel im Nachhinein) getroffen und ist in hohem Maße von den Umständen des Einzelfalls abhängig. Diese Akzeptanz ist in erster Linie das Ergebnis eines politischen und gesellschaftlichen Diskussionsprozesses; sie kann weder durch eine technische noch durch eine juristische Definition herbeigeführt oder ersetzt werden.
Wahrscheinlich wird ein künftiger Kriegsgegner sich in seiner psychologischen Kriegführung diesen Sachverhalt sehr viel geschickter zunutze machen, als es im Kosovokrieg die serbische Propaganda vermochte. Deren im Übermaß vorgetragene Behauptungen, NATO-Luftangriffe hätten Wohngebiete, Krankenhäuser und Schulen zum Ziel gehabt, unterminierte letztlich nur die serbische Glaubwürdigkeit weiter. In zukünftigen Konflikten wird der Vorwurf gegen westliche Staaten, gegen die eigenen ethischen Grundsätzen zu verstoßen, mit großer Sicherheit der Kernpunkt eines intensiven öffentlichen Propagandakrieges sein, der parallel zu den physischen Kampfhandlungen stattfinden wird und diese an Bedeutung sogar übertreffen könnte.
IV. Clausewitz und die Transformation des Krieges
Im westlichen Verständnis ist Krieg - ganz im Sinne Carl von Clausewitz' (1780-1831) - als Fortsetzung der Politik, als Ultima Ratio zu begreifen. In seinen eigenen Worten: "So sehen wir also, dass der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches Instrument ist, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln."
In den westlichen liberalen Gesellschaften und Staaten ist diese Clausewitz'sche Auffassung, welche die rationalen Momente politischen Handelns in den Mittelpunkt stellt, zu einem wesentlichen Teil des politischen und zivilisatorischen Selbstverständnisses geworden. Dies gilt auch für die in engem Zusammenhang damit stehenden Grundsätze, wie etwa die bereits behandelte Unterscheidung von Kombattanten und Nichtkombattanten oder die im Folgenden angesprochene klare Unterscheidbarkeit von Krieg und Frieden als sich jeweils gegenseitig ausschließende Rechtszustände zwischen Staaten. Es wäre naiv zu glauben, dass man diese Grundwerte und Einstellungen kurzfristig verändern könnte, oder auch, dass man sie ändern könnte, ohne damit zugleich den Charakter liberaler Demokratien substanziell in Frage zu stellen.
Mit der Zunahme der kleinen Kriege findet jedoch eine fundamentale Transformation des Gesamtphänomens Krieg statt, die Kriege immer mehr aus der zweckrationalen Sphäre politischen Handelns herauszulösen scheint: Denn für die Entscheidung zum Krieg können nicht nur zweckrationale Erwägungen - die Interessen - ausschlaggebend sein, sondern auch für Dritte sehr viel schwerer nachvollziehbare ideologische oder emotionale Gründe. Darüber hinaus kann Krieg auch ein sich selbst genügender Zweck sein, etwa wenn Gewaltausübung zur Lebensform wird. Der zweckrationale Erklärungsansatz im Sinne einer Zweck-Mittel-Relation ist vor allem da nicht mehr erklärungsmächtig, wo Kriegführende um ihre Existenz oder als Ausdruck ihrer Identität Krieg führen. Auch der von westlicher Seite verschiedentlich angeführte Kriegsgrund der "Wahrung der eigenen Glaubwürdigkeit" ist keineswegs so rational und für Dritte nachvollziehbar, wie es den Anschein haben mag.
Wie sehr das Ziel eines nichtstaatlichen Akteurs in einem kleinen Krieg von dem klassischen zweckrationalen Denkschema abweichen kann, macht eine Beobachtung Henry Kissingers während des Vietnamkrieges deutlich: "Die Guerilla gewinnt, wenn sie nicht verliert. Die konventionelle Armee verliert, wenn sie nicht gewinnt." Reguläre Streitkräfte stehen in einem kleinen Krieg in dem Dilemma, dass der Gegner bereits aus der Tatsache eines andauernden Konfliktes Bestätigung der eigenen Ziele sowie Legitimität und Anerkennung auf internationaler Ebene gewinnt, und zwar unabhängig vom eigenen militärischen Erfolg. Eine Intensivierung des Konfliktes zur Niederwerfung des nichtstaatlichen Gegners - was in einem zwischenstaatlichen Krieg die präferierte Vorgehensweise wäre - kann sich unter diesen Vorzeichen in einem kleinen Krieg leicht als kontraproduktiv erweisen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn eigene Verluste an Menschenleben für den staatlichen Akteur ein größeres Problem darstellen als für den nichtstaatlichen Gegner.
In der Clausewitz'schen Definition von Krieg "als Fortsetzung und Durchführung des politischen Verkehrs mit anderen Mitteln" ist die klar erkennbare Unterscheidbarkeit von Krieg und Frieden angelegt. Auch sie ist zu einem festen Bestandteil der modernen politischen Vorstellungswelt geworden. Das bekannte Axiom von Hugo Grotius (1583-1645), dass es zwischen Krieg und Frieden kein Drittes gebe, traf allerdings immer nur auf das als Rechtszustand definierte Verhältnis zwischen Staaten zu. Und selbst hierbei sind im 20. Jahrhundert rechtliche Grauzonen entstanden, etwa bei Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung von Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates. Ein Wesensmerkmals des kleinen Krieges ist jedoch gerade die Unmöglichkeit einer klaren Unterscheidung von Krieg und Frieden.
Die Clausewitz'sche Sicht des Verhältnisses von Krieg und Politik weist einen weiteren zentralen Schwachpunkt auf: Für das Verständnis des Krieges im 20. und 21. Jahrhundert - und zwar sowohl des großen wie des kleinen Krieges - greift seine Definition, dass Krieg "ein Akt der Gewalt (ist), um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen", zu kurz. Sie beinhaltet als unausgesprochene Prämisse, dass der unterlegene Gegner nach dem Krieg physisch fortexistiert. Damit lassen sich aber gerade die für das 20. (und vermutlich auch für das 21.) Jahrhundert so charakteristischen Kriegsformen nicht mehr fassen: Im Vernichtungskrieg und in ethnisch motivierten Konflikten bedeutet der "Wille" der einen Seite die vollständige Auslöschung der anderen Seite (und nicht etwa nur ihrer Führung bzw. ihrer Kombattanten); ein Unterwerfen unter diesen Willen, um den Krieg zu beenden, käme einem kollektiven Suizid gleich. Bei diesen tendenziell genozidalen Kriegstypen konvergieren, in den Kategorien von Clausewitz, das militärstrategische Ziel und der politische Zweck, nämlich die Auslöschung der kollektiven Identität und physischen Existenz des Gegners. Dem Gegner wird hier die Möglichkeit genommen, durch Einlenken auf Dauer und Verlauf des Krieges Einfluss zu nehmen. Übrigens würde auch ein denkbarer massiver nuklearer Schlagabtausch, der die Territorien der Krieg führenden Staaten und möglicherweise sogar die gesamte Erde unbewohnbar machen würde, notwendigerweise die Grenzen der Clausewitz'schen Definition sprengen.
V. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
1. Kleine Kriege und große Kriege
Die zwischenstaatlichen, die großen Kriege werden nicht aus dem Konfliktspektrum des 21. Jahrhunderts verschwinden. Aber sie werden angesichts der Vervielfältigung der Konfliktformen und insbesondere aufgrund der Zunahme kleiner Kriege eine - relativ gesehen - weniger wichtige Rolle spielen. Nichtsdestoweniger handelt es sich bei den großen Kriegen um diejenige Kriegsform, für die westliche Staaten aufgrund ihres Selbstverständnisses und aufgrund ihres Potenzials an militärischem Großgerät am besten gerüstet sind. Sie werden daher dazu tendieren, militärische Konflikte auch weiterhin auf der Ebene der großen Kriege auszutragen. Ob dies jedoch gelingen wird und ob dies dann gegen nichtstaatliche Akteure zu den angestrebten militärischen Erfolgen führen wird, muss offen bleiben.
Christopher Daase hat überzeugend argumentiert, dass es eine Reihe von Gründen gibt, warum Staaten bzw. reguläre Streitkräfte trotz ihrer überlegenen militärischen Machtmittel prinzipiell große Schwierigkeiten haben, sich in asymmetrischen Konflikten gegen nichtstaatliche Akteure durchzusetzen: Das Grunddilemma des kleinen Krieges ist, dass in einem asymmetrischen Konflikt zwischen einem staatlichen und einem nichtstaatlichen Akteur der Staat erhebliche Nachteile hat. Das Führen kleiner Kriege setzt westliche Staaten bzw. Gesellschaften heftigen Spannungen und Verwerfungen aus. Sie geraten durch die Regellosigkeit und Entgrenzung des Krieges in Widerspruch zu ihren eigenen politischen und ethnischen Grundlagen und gefährden damit ihre Gesellschaftsordnung. Der nichtstaatliche Gegner zieht aus der Nichtanwendung von Regeln hingegen ausschließlich Vorteile, in erster Linie den eines größeren Handlungsspielraums. Das Selbstverständnis der westlichen Gesellschaften legt ihren Streitkräften also Beschränkungen auf, die von den Gegnern in kleinen Kriegen nicht geteilt werden; sie betreffen insbesondere die Unterscheidung von Kombattanten und Nichtkombattanten. Verletzt aber ein staatlicher Akteur seine eigenen Regeln zur Kriegführung, kann sich eine innenpolitische Opposition oder der Kriegsgegner leicht diesen Umstand argumentativ zunutze machen.
2. Kombattanten und Nichtkombattanten
In einem zentralen Punkt konvergieren die kleinen Krieg auf der einen Seite und die Entwicklungen innerhalb des großen Krieges auf der anderen Seite, nämlich bei der problematischen Unterscheidung von Kombattanten und Nichtkombattanten bzw. von zivilen und militärischen Zielen. Die seit dem 19. Jahrhundert und durch das ganze 20. Jahrhundert zu konstatierende Tendenz zur Totalisierung des großen Krieges macht diese Unterscheidung immer schwieriger. Damit geht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem regellosen kleinen Krieg und dem durch internationales Recht eingehegten großen Krieg verloren. Anders gesagt: Die Schonung von Zivilisten und zivilen Einrichtungen im Krieg beruht auf Voraussetzungen, die heute immer weniger gegeben sind.
Ob westliche Gesellschaften ihre Haltung bezüglich der Behandlung von Nichtkombattanten überhaupt aufgeben können, bleibt offen. Wenn sie es aber tun, wird sich ihr zivilisatorisches Selbstverständnis substanziell verändert haben müssen. Und es gibt durchaus erste Denkansätze in diese Richtung: In der Folge des Kosovokrieges ist es in Kreisen amerikanischer Militärjuristen zu einer Diskussion über den zukünftigen Status der gegnerischen Zivilbevölkerung gekommen. Ausgehend von der Einschätzung, dass die Politik der jugoslawischen Regierung gegenüber dem Kosovo nicht nur von der Regierung Milosevic, sondern von der Mehrheit der serbischen Bevölkerung getragen wurde, wird erwogen, ob nicht sinnvollerweise der völkerrechtlich festgeschriebene Nichtkombattantenstatus der Bevölkerung durch eine formelle Änderung der Rechtsnorm teilweise eingeschränkt werden sollte. Dadurch würden Angriffe auch auf rein zivile Einrichtungen, wie etwa Banken, Fabriken, Geschäfte sowie kulturelle und historisch wertvolle Objekte - wenn auch noch nicht auf Zivilpersonen selbst - möglich, um auf diese Weise den Druck auf den Gegner zu erhöhen.
Der Ausgangspunkt der Argumentation, dass die Krieg auslösende Politik gegenüber dem Kosovo nicht von einer verbrecherischen Regierung dem eigenen Volk gegen dessen Willen aufgezwungen wurde, sondern dass weite Teile der Bevölkerung diese Politik ihres gewählten Präsidenten bereitwillig mittrugen, ist nicht von der Hand zu weisen. Diese Konstellation dürfte für ethnisch motivierte Konflikte nicht untypisch sein. Doch konsequent zu Ende gedacht bedeutet dieser Denkansatz, dass letztendlich doch die gegnerische Bevölkerung zum legitimen Ziel von Kampfhandlungen werden könnte. Dies wäre spätestens dann der Fall, wenn Angriffe auf die rein zivile Infrastruktur nicht die erwartete Wirkung entfalten. Am Ende der Entwicklung verschwände der zentrale Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen Krieg. Dies würde nichts weniger als eine weitgehende Rückkehr zu dem regellosen Zustand des Dreißigjährigen Krieges bedeuten.
3. Politische Rahmenbedingungen von Streitkräfteeinsätzen
Aus der im westlichen Verständnis grundsätzlich politischen Natur des Krieges folgt zum einen, dass Krieg eine dezidiert öffentliche Angelegenheit ist - und in der Mediengesellschaft in Zukunft auch bleiben wird. Parallel zu Kampfhandlungen wird es sowohl innerhalb der Krieg führenden Gesellschaften wie in der internationalen Politik heftige und breit angelegte Auseinandersetzungen über die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit des jeweiligen Militäreinsatzes geben. Der Kampf um die Meinungsführerschaft in den Medien, die Beeinflussung des Denkens der eigenen wie der gegnerischen Bevölkerung wird ein nicht mehr wegzudenkender integraler Bestandteil militärischer Operationen und des dahinter stehenden politisch-strategischen Kalküls sein. Die nationale wie die internationale Öffentlichkeit ist ein Raum, in dem Kriege zukünftig ebenso intensiv, ebenso wirkungsvoll und vielleicht sogar ebenso entscheidend geführt werden wie auf dem Gefechtsfeld.
Ferner wird die Politik auch weiterhin großen und unmittelbaren Einfluss auf den Verlauf von Streitkräfteeinsätzen nehmen - sei es durch die Vorgabe minimaler Kollateralschäden bzw. des Vermeidens eigener Verluste, durch die Forderung nach rasch sichtbaren Erfolgen oder durch die zahlenmäßige Begrenzung bzw. spezifische Zusammensetzung der eingesetzten Truppen. Weitere politische Faktoren, aus denen durchaus Einschränkungen der Effektivität von Militäreinsätzen resultieren können, sind die Dauer der politischen Entscheidungsprozesse, bevor es überhaupt zu einem Streitkräfteeinsatz kommt, die Notwendigkeit des coalition-building innerhalb von NATO bzw. EU und auf internationaler Ebene sowie die Beteiligung an Militäreinsätzen aus Bündniserwägungen heraus oder als politische Geste, ohne dass vitale nationale oder Bündnisinteressen berührt sind. Aus militärischer Sicht mögen diese politischen Beschränkungen entbehrlich, um nicht zu sagen: kontraproduktiv, sein. Doch handelt es sich bei ihnen um eine Folge des Primats der Politik und damit um eine nicht veränderbare Rahmenbedingung von Militäreinsätzen in liberalen Demokratien. Die Vorstellung, dass in Militäreinsätzen ausschließlich nach militärischen Erfordernissen und ohne Einmischung der Politik gehandelt werden könnte, verkennt die grundsätzliche politische Natur dieser Einsätze. Auch zukünftig wird also politisches Makro- und Mikro-Management von militärischen Konflikten der Regelfall sein.
Ein Paradoxon in diesem Zusammenhang ist die für die öffentliche Akzeptanz der Entscheidung zu militärischen Operationen als unverzichtbar empfundene Dämonisierung des Gegners: So wurden etwa Saddam Hussein und Slobodan Milosevic von den westlichen Regierungen als grausamste Verbrecher gegen die Menschlichkeit dargestellt, um in der eigenen Öffentlichkeit den Rückhalt für den Einsatz von Streitkräften herzustellen. Damit nahm man sich aber auch die Möglichkeit, zur Beendigung der bzw. im Anschluss an die Kampfhandlungen zu einem diplomatischen Geben-und-Nehmen mit der gegnerischen Führung zurückzukehren, denn mit einem einmal dämonisierten Gegner kann man sich auf keine substanziellen Verhandlungen in der Sache selbst mehr einlassen. Durch die Dämonisierung entsteht also ein selbstverursachter Druck, den Krieg solange fortzusetzen, bis die gegnerische Seite auf alle wesentlichen Forderungen eingegangen ist; dies bedeutet tendenziell eine Intensivierung und Verlängerung der Kampfhandlungen.
4. Zum Verhältnis von Krieg und Politik
Doch was kommt nach dem militärischen Erfolg im Krieg? Nach westlichem Verständnis geht es bei einem Krieg, wie Michael Howard deutlich gemacht hat, letztlich nicht um den Sieg an sich, sondern darum, durch den militärischen Sieg eine Veränderung der politischen Lage herbeizuführen, die zum Ausbruch eines Krieges geführt hat; und zwar eine Veränderung, die auch von der unterlegenen Seite dauerhaft akzeptiert wird. Gerade unter dem Vorzeichen von Krieg als einem Mittel der Politik kann es nicht ausreichen, lediglich auf dem Gefechtsfeld militärisch zu obsiegen. Von entscheidender Bedeutung ist in letzter Konsequenz immer der politische Kontext, in dem ein solcher Konflikt stattfindet. So haben die militärischen Erfolge gegen den Irak 1990/91 und gegen Restjugoslawien 1999 zwar eine neue Lage geschaffen, aber die tieferen Ursachen der Konflikte (zumindest bislang) nicht beseitigt.
Aber können und wollen westliche Staaten Krieg auf eine solche Weise führen, dass sowohl die Führung als auch die Bevölkerung des Gegners durch die Drohung mit der völligen Vernichtung bzw. durch dauerhafte Besetzung und Souveränitätsverlust zu einer grundlegenden Revision ihrer Haltung bewogen werden? Nach Michael Howards Argumentation war es genau dieser Umstand, der in der Folge der Niederlage im Zweiten Weltkrieg - und im Unterschied zu der Situation nach dem Ersten Weltkrieg - einen radikalen Paradigmenwechsel in der deutschen Gesellschaft und Politik zur Folge hatte. Ein solches Vorgehen dürfte jedoch, zumindest bei interventionistischen Einsätzen, bei denen vitale Interessen der intervenierenden Mächte nicht berührt sind, kaum eine reale Option sein.
Es stellt sich daher die Frage, ob Militäreinsätze westlicher Staaten überhaupt gerechtfertigt werden können (sei es unter ethischen oder auch nur unter politisch-pragmatischen Gesichtspunkten), wenn der militärische Erfolg - bzw. die darauf aufbauenden nichtmilitärischen Maßnahmen - zu keiner grundlegenden und dauerhaften Veränderung der politischen Lage führen. Mit diesem Maßstab werden sich künftige Entscheidungen über den Einsatz militärischer Mittel als Instrument der Politik messen lassen müssen.
Dieser Maßstab nimmt vor allem die Politik in die Pflicht. Der in dem Clausewitz'schen Diktum vom Krieg als Fortsetzung der Politik angelegte Primat der Politik bedeutet nicht nur die Unterordnung des Militärs unter die Politik; er legt auch der Politik der westlichen Staaten bei der Entscheidung für einen Militäreinsatz - und für die sich daran anschließende politische Umsetzung - eine besondere Verantwortung auf: Der Einsatz militärischer Mittel bewirkt, für sich alleine genommen, nur in seltenen Fällen eine unmittelbare Problemlösung; dies gilt auch für eine jahre- oder gar jahrzehntelange Stationierung von Friedenstruppen.
Es kann daher nicht genügen - wenn die Diplomatie sich in eine Sackgasse manöviert hat -, nach dem militärischen Befreiungsschlag zu rufen. Ohne eine an den militärischen Erfolg anknüpfende diplomatische Fortführung und Umsetzung - und eine daraus resultierende grundlegende und auch von der unterlegenen Seite akzeptierte Veränderung der politischen Ausgangslage - sind Militäreinsätze als Mittel der Politik im 21. Jahrhundert weder sinnvoll noch zu verantworten.
Quelle: Martin Hoch in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 20/ 2001 vom 11. Mai 2001, S. 17-25
Terrorismus
zurück |
|
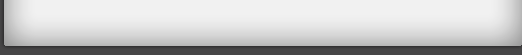 |
|
|
|
|
|
Es wurden im Rahmen einer Aufräumaktion einige Menüpunkte entfernt.
Das Gästebuch und das Kontaktformular wurden von mir deaktiviert, da ich diese Seite nicht mehr aktiv betreibe.
Am 16.02.17 reise ich mit meinen Kindern zum Marinestützpunkt meines Bruders. Wir dürfen bei der Vereidigung zusehen. |
|
|
 |
|
| |
|
|